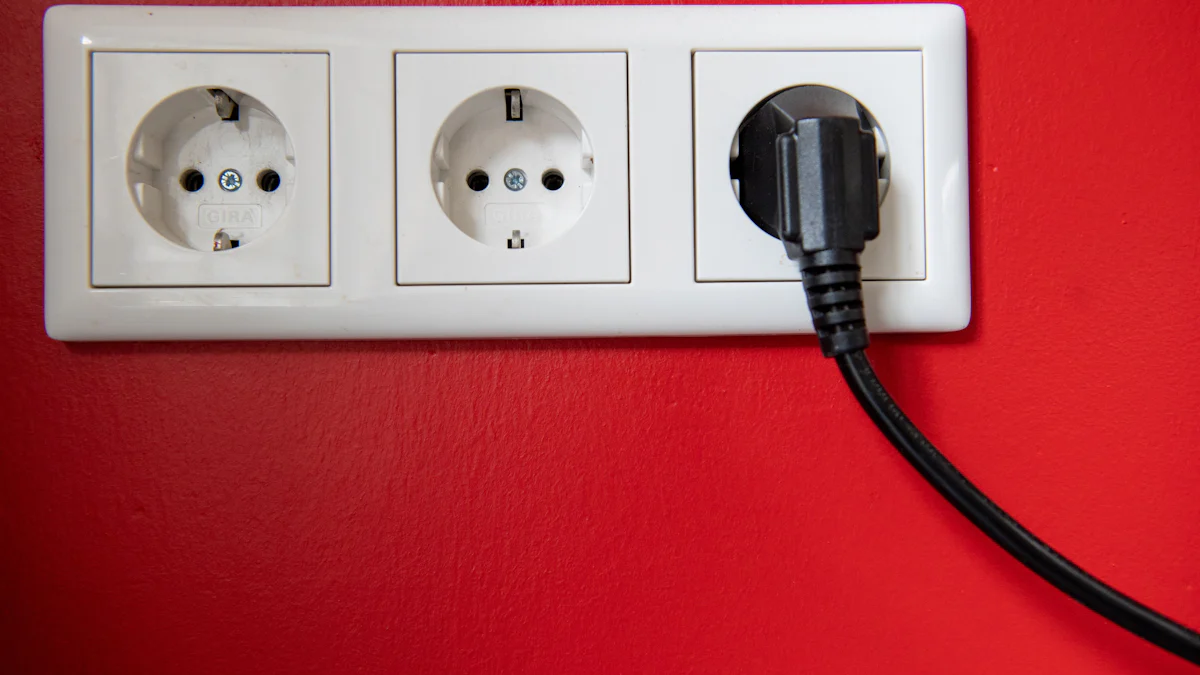Die Bundesregierung hat im Koalitionsausschuss beschlossen, die Ausweitung der Mütterrente bereits Anfang 2027 einzuführen. Gleichzeitig kündigte Arbeitsministerin Bärbel Bas eine zweistufige Reform des Bürgergelds an, um Einsparungen im Sozialhaushalt zu erzielen.
Ausweitung der mütterrente: Umsetzung trotz kritik der deutschen rentenversicherung
Der Koalitionsausschuss hat entschieden, die von Schwarz-Rot geplante Ausweitung der Mütterrente bereits Anfang 2027 umzusetzen – ein Jahr früher als von der Deutschen Rentenversicherung vorgeschlagen. Die DRV hatte ursprünglich einen Start frühestens 2028 empfohlen und auf die hohe Komplexität bei der praktischen Umsetzung hingewiesen. Im Beschlusspapier heißt es jedoch: „Sofern eine technische Umsetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist, wird die Mütterrente rückwirkend ausgezahlt.“
Diese rückwirkende Auszahlung stößt bei der DRV auf scharfe Kritik. Anja Piel, Vorsitzende des DRV-Bundesvorstandes, erklärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung: „Die rückwirkende Auszahlung ist nicht schaffbar und sie macht auch wenig Sinn.“ Sie betonte zudem den enormen Mehraufwand für die Beschäftigten in den Rentenkassen. Die höhere Mütterrente betrifft etwa zehn Millionen Rentenbeziehende und muss häufig mit anderen Leistungen wie Grundrente oder Hinterbliebenenrenten verrechnet werden. Dies erfordere eine vollständige Neugestaltung des Verfahrens zur Leistungsberechnung.
Unternehmer begrüßen den Aufschub hingegen aus finanziellen Gründen: Die jährlichen Kosten von rund fünf Milliarden Euro Steuerzuschuss verschieben sich damit nach hinten und entlasten kurzfristig den Staatshaushalt.
Bürgergeldreform in zwei schritten geplant – einsparziele bleiben umstritten
Das bestehende Bürgergeld soll durch eine neue Grundsicherung ersetzt werden, deren Einführung in zwei Schritten erfolgen soll. Arbeitsministerin Bärbel Bas kündigte an, dass ein erster Gesetzentwurf noch im Herbst vorgelegt wird; Ende des Jahres folgt dann ein umfassender Reformvorschlag.
Im Gegensatz zur Ausweitung der Mütterrente enthält das Beschlusspapier keine konkreten Angaben zu erwarteten Einsparungen durch diese Reform. Das Finanzministerium hatte zuvor prognostiziert, dass 2026 rund 1,5 Milliarden Euro und 2027 etwa drei Milliarden Euro eingespart werden könnten – unter anderem durch strengere Sanktionen bei verpassten Terminen im Jobcenter sowie verstärkten Kampf gegen Sozialbetrug.
Skeptische stimmen zur sparsumme
Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit , zeigte sich skeptisch bezüglich dieser Sparziele: Um allein 1,5 Milliarden Euro einzusparen müssten etwa 100.000 erwerbsfähige Bezieher komplett aus dem System ausscheiden – was zwar möglich sei, aber schwierig bleibe. Zudem seien frühere Berechnungen mit anderen Annahmen erfolgt; so habe das Bundesarbeitsministerium auch Kinder berücksichtigt sowie andere Gruppen als die BA heute kalkuliert.
Ein wesentlicher Beitrag zu den Einsparungen soll zudem aus einer geänderten Regelung für ukrainische Geflüchtete kommen: Neuankömmlinge sollen künftig statt Bürgergeld nur noch Leistungen wie Asylbewerber erhalten – was jährlich rund 900 Millionen Euro weniger Kosten bedeutet.
Nahles fasste zusammen: „Wenn man alles zusammennehme“, seien Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro im kommenden Jahr „machbar“. Für drei Milliarden Euro müsse jedoch ein deutlicher Wirtschaftsaufschwung hinzukommen.
Energiekosten bleiben thema ohne neue entscheidungen
Der Koalitionsausschuss bestätigte seine bisherige Linie zur Entlastung bei den Energiekosten ohne weitere Änderungen am bisherigen Kurs vorzunehmen. Die Bundesregierung plant weiterhin eine Senkung der Stromsteuer für rund 600.000 Unternehmen als Sofortmaßnahme gemäß Koalitionsvertrag.
Allerdings besteht innerhalb von Schwarz-Rot Uneinigkeit darüber, ob dafür fünf Milliarden Euro an anderer Stelle im Haushalt gekürzt werden sollen oder nicht. Der Ausschuss verabschiedete lediglich eine Absichtserklärung zur Senkung dieser Steuer auch für alle Stromkunden „sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen“.
Damit bleibt offen, wann private Verbraucher konkret entlastet werden können; bislang profitieren hauptsächlich Unternehmen von steuerlichen Erleichterungen beim Strompreis.